


Oft möchte man in der Spektroskopie mehrere Lichtquellen gleichzeitig nutzen – sei es zur Untersuchung von Überlagerungseffekten, zur Kalibration eines Spektrometers oder zur Erzeugung komplexerer Lichtspektren. Dabei können unterschiedliche Lichtfarben oder Laserquellen miteinander kombiniert werden, um neue Messszenarien zu schaffen und gezielt bestimmte Spektralbereiche anzuregen. Solche Experimente erlauben es, Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Lichtquellen zu beobachten, die Genauigkeit von Messungen zu erhöhen oder die Analyse spezieller Materialien zu optimieren.
Hierfür braucht es jedoch nicht unbedingt teure optische Komponenten: Mit handelsüblichen Toslink-Verteilern, die wir ohnehin schon für unsere DIY-Spektrometer nutzen, lassen sich Lichtsignale ganz einfach splitten und kombinieren. Auf diese Weise können mehrere Lichtquellen parallel genutzt werden, ohne dass aufwendige Strahlteiler oder Spezialoptiken erforderlich sind. Solche Lösungen sind robust, kostengünstig und leicht in bestehende Versuchsaufbauten integrierbar, wodurch sie gerade für Lehr- und Forschungseinrichtungen besonders attraktiv sind.
Ein Lichtleiter-Verteiler ermöglicht zwei grundlegende Anwendungen:
Durch die Kaskadierung mehrerer Verteiler können sogar mehrere Lichtquellen kombiniert werden. Ein einfacher Trick zur Anpassung unterschiedlicher Intensitäten: Wird ein Signal über längere Lichtleiter geführt, schwächt es sich ab – dadurch lassen sich die Quellen gut angleichen. Bei den Toslink-Lichtleitern sind z. B. auch Längen von bis zu 10 m erhältlich, die nur unwesentlich mehr als die kürzeren Versionen kosten.
Neben den Lichtleiter-Verteilern gibt es auch noch Umschalter, mit denen zwischen mehreren Lichtquellen gewählt werden kann. Solche Umschalter ermöglichen es, gezielt einzelne Lichtquellen ein- oder auszuschalten, ohne die gesamte optische Verkabelung ändern zu müssen. So kann man beispielsweise zwischen einer UV-LED für Fluoreszenzmessungen, einer roten Laserdiode für Absorptionsstudien und einer weißen LED für Transmissionsspektren hin- und herschalten.
Auch komplexere Messaufbauten profitieren davon: In einem Experiment zur Pflanzenforschung könnte man zunächst eine Blaulichtquelle aktivieren, um Chlorophyll zu stimulieren, und dann auf eine Rotlichtquelle umschalten, um die Photosyntheserate zu beobachten. Solche Umschalter machen den Versuch flexibel, sparen Zeit und erlauben ein schnelles Anpassen des Lichtspektrums an die jeweiligen Anforderungen – und das alles ohne teure mechanische Komponenten oder aufwendige Neuverkabelungen.
Natürlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass sowohl die Lichtleiter-Verteiler als auch die Lichtleiter-Umschalter zu Verlusten in der übertragenen Lichtmenge führen. Bei Low-Light-Applikationen kann dies schnell zu einem Problem werden. Für viele Experimente in der Lehre reichen aber die vorhandenen Intensitäten der Lichtquellen in der Regel aus, um diese Verluste durch eine längere Integrationszeit des Detektors im Spektrometer wieder zu kompensieren.
Lichtleiter-Verteiler lassen sich gezielt für die Kalibration von Spektrometern nutzen. Ein besonders praxisnahes Szenario ist die Überlagerung von drei Laserdiodenmodulen (z. B. 405 nm, 520 nm, 652 nm), deren scharfe Emissionslinien dann als Referenzlinien dienen. Module dieser Wellenlängen sind mittlwerweile recht preiswert zu bekommen, weil diese u. a. in Laserpointern eingesetzt werden.
Mithilfe von zwei Verteilern werden die drei Laserstrahlen in einen einzigen Lichtleiter geführt und so gleichzeitig in das Spektrometer eingekoppelt. Das resultierende Spektrum zeigt die drei einzelnen Peaks.
Das obenstehende Spektrum entstand mit unserem DIY-Spektrometer in Czerny-Turner-Anordnung mit 10 µm-Spalt, f = 150 mm Brennweite, 600 lp/mm Gitter und Zeilenkamera e9u-LSMD-TCD1304-STD.
Laserdioden reagieren auf Temperaturschwankungen: Die Peak-Wellenlängen verschieben sich daher je nach Temperatur leicht (typischerweise einige Zehntel Nanometer pro Grad). Daher ist es sinnvoll, die Lage der Peaks zunächst bei definierter Raumtemperatur zu messen und zu notieren. Diese Referenzwerte dienen dann als Ausgangspunkt für eine erste Grobjustage und -kalibration, selbst wenn die Labortemperatur von der ursprünglichen Raumtemperatur abweicht. Anschließend werden dann zusätzliche, stabile Referenzquellen herangezogen, z. B. Emissionen einer Neon-Glimmlampe, um das Spektrometer final auf maximale Genauigkeit zu kalibrieren.
Für Hochschulen oder Schulen bietet die Überlagerung mehrerer Lichtquellen ein besonders anschauliches Demonstrationsbeispiel. Studierende können im Spektrum unmittelbar erkennen, wie sich einzelne LEDs oder Laserlinien überlagern und ein komplexeres Gesamtspektrum entsteht. Auf diese Weise wird das abstrakte Konzept der spektralen Zusammensetzung von Licht sehr greifbar.
Das Experiment eignet sich hervorragend für Lehrversuche zur Spektralanalyse, zur Farbenlehre sowie zur Laserspektroskopie. So lässt sich beispielsweise zeigen, warum eine bestimmte Farbmischung im sichtbaren Bereich »weiß« erscheint, obwohl sie eigentlich aus einzelnen scharfen Spektrallinien besteht. Auch Unterschiede zwischen schmalbandigen Lichtquellen (Laserdiode) und breitbandigeren LEDs können so leicht nachvollzogen werden.
Darüber hinaus vermittelt das Beispiel praxisnah, wie Spektrometer in der Forschung eingesetzt werden: nämlich nicht nur zur Untersuchung einzelner Lichtquellen, sondern auch zur Analyse von Kombinationen, wie sie in realen Anwendungen häufig auftreten. Damit wird der Aufbau zu einem idealen Einstiegsexperiment, das sowohl Grundlagen vermittelt als auch zum eigenständigen Weiterdenken anregt.
Mit Hilfe eines Lichtleiter-Verteilers haben wir in das Spektrum einer Neon-Glimmlampe zusätzlich die Emission einer roten Laserdiode eingekoppelt. Auf den ersten Blick erscheint das Spektrum wie ein typisches Neon-Spektrum mit seinen zahlreichen scharfen Linien. Erst bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass sich eine einzelne Linie nicht in das bekannte Muster einfügt.
Im Rahmen eines Versuches können Schüler:innen oder Studierende nun die Aufgabe erhalten, das »falsche« Signal zu identifizieren. Dadurch üben sie nicht nur die Zuordnung von Emissionslinien zu einem bestimmten Element, sondern schärfen auch ihren Blick für Abweichungen in experimentellen Daten. Genau solche Fragestellungen sind es, die den Unterschied zwischen reinem Ablesen und echter Analysekompetenz ausmachen.


Ausschnitt aus dem Spektrum einer Neon-Glimmlampe. Einmal im Original und einmal mit zusätzlicher Laserdioden-Linie.
Die Methode lässt sich auch erweitern: Statt einer roten Laserdiode könnte man eine LED einer anderen Farbe einmischen, mehrere Fremdlinien gleichzeitig unterbringen oder sogar schwache Linien im Hintergrund verstecken. Je nach Schwierigkeitsgrad können Lehrende das Experiment so anpassen, dass sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene Spektroskopie-»Profis« gefordert werden.
Am Ende steht immer dieselbe spannende Frage: Wer erkennt die »fremde« Linie im Spektrum – und wie sicher ist die Zuordnung? Genau dieser spielerische Ansatz macht das Suchspiel zu einer idealen Übung, die Spaß macht und gleichzeitig das Verständnis für die Funktionsweise von Spektrometern und die Bedeutung von Referenzspektren vertieft.
DIY-Variante
Neben der Nutzung handelsüblicher TosLink-Verteiler kann man mit etwas handwerklichem Geschick auch ein eigenes kleines Gerät zum Überlagern von Lichtquellen bauen. Dazu benötigt man lediglich unummantelte Kunststofflichtleiter (als Meterware erhältlich) sowie 3D-gedruckte Halterungen, um einzelne Lichtleiterstücke an den Lichtquellen zu befestigen und diese anschließend präzise zu einem gemeinsamen Ausgang für den Lichtleiter zum Spektrometer zusammenzuführen.
Mit diesen einfachen Mitteln lassen sich beispielsweise drei Laserdiodenlinien zu einem kompakten Überlagerungsaufbau kombinieren – wie im ersten Spektrum oben zu sehen. Ein solches Gerät ist auch auf dem ersten Bild dieser Seite dargestellt.
Bausatz in Planung: Eureca wird in Kürze ein kleines Set anbieten , mit dem Sie ein solches Überlagerungsgerät für drei Laserdiodenlinien unkompliziert selbst zusammenbauen können. Wer Interesse hat, kann uns auf LinkedIn oder per Newsletter folgen, um informiert zu bleiben.
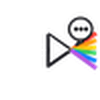 Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.
Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 31.10.2025
