


Wunderkerzen sind faszinierende pyrotechnische Produkte, die ein charakteristisches Funkenregen- und Glühphänomen erzeugen. Deren Spektrum sind eine ideale und leicht zugängliche Lichtquelle, an der einfach demonstriert werden kann, dass angeregte Atome nicht nur Emissionslinien erzeugen können, sondern durch Absorption von Strahlung gleicher Wellenlänge auch Absorptionslinien verursachen können.

Eine Wunderkerze besteht meist aus einem dünnen, stabilen Metall (oft Stahldraht), der als Träger für die pyrotechnische Mischung dient. Der Stab bleibt während des Abbrennens stabil und dient als Griff.
Eine dicke Schicht aus einer pyrotechnischen Mischung wird auf diesen Stab aufgebracht. Sie enthält als Oxidationsmittel in der Regel Kaliumperchlorat (KClO4) oder Kaliumchlorat (KclO3). Als Brennstoff wird oft Kohle oder Zucker verwendet. Metallpulver wie Aluminium, Magnesium oder Eisen sind verantwortlich für die Funkenbildung und die charakteristische Optik. Bindemittel wie Stärke oder Dextrin, mit Wasser oder Alkohol gemischt, hält die Mischung am Stab. Am oberen Ende der Wunderkerze wird manchmal auch eine zusätzliche leicht entzündbare Mischung verwendet, die das Anzünden erleichtert.
Durch eine Flamme oder einen Funken wird die Zündspitze entzündet. Die entstehende Hitze bringt die pyrotechnische Beschichtung zum Abbrennen. Das Oxidationsmittel setzt Sauerstoff frei, der die Verbrennung des Brennstoffs ermöglicht. Die Metallpartikel in der Mischung erhitzen sich stark und verbrennen mit intensiver Funkenbildung. Die glühenden Metallpartikel werden durch die Verbrennung in die Luft geschleudert, oxidieren hierbei und erzeugen helle Funken, bevor sie abkühlen.
Achtung: Wunderkerzen erzeugen hohe Temperaturen (über 1000 °C) und gesundheitsschädlichen Rauch, daher sollten sie nur in gut belüfteten Bereichen und mit Vorsicht verwendet werden.
Wunderkerzen erzeugen beim Abbrennen ein kontinuierliches Spektrum, das hauptsächlich durch die thermische Emission der glühenden Metallpartikel erzeugt wird. Es handelt sich dabei um ein Kontinuum, dessen Form von der Temperatur der glühenden Partikel (z. B. Eisen, Aluminium oder Magnesium) und den genutzten Materialien abhängt.
Das kontinuierliche Spektrum einer Wunderkerze entspricht im Wesentlichen einer Planck-Kurve für Temperaturen zwischen 2000 K und 3000 K. Es zeigt somit eine hohe Intensität im roten und gelben Bereich, mit abnehmender Intensität zu blauen und UV-Wellenlängen. Zusätzliche schmale Spektrallinien können durch chemische Zusätze (z. B. Natrium, Barium, Kalium) auftreten und das kontinuierliche Spektrum überlagern.
Die genauen Eigenschaften des kontinuierlichen Spektrums hängen von den verwendeten Materialien in der Wunderkerze ab. Eisen oder Stahlpulver führt zu einem Spektrum mit intensiver Strahlung im roten und infraroten Bereich, während Magnesium ein helleres Spektrum mit mehr Emission im blauen und UV-Bereich liefert, da es höhere Temperaturen erreicht. Aluminium verhält sich ähnlich wie Eisen, aber mit einer stärkeren Emission im mittleren sichtbaren Bereich.
Auch die Größe der Metallpartikel beeinflusst die Strahlungsintensität. Feine Partikel glühen schneller auf und erreichen höhere Temperaturen, was ein helleres und breiteres Spektrum erzeugt. Grobe Partikel hingegen glühen langsamer und kühler, wodurch das Spektrum intensiver im roten Bereich wird.
Über dem kontinuierlichen Spektrum können oft Emissionen von Metallen und Salzen sichtbar werden, die in der Wunderkerze enthalten sind. Häufig zu finden ist die charakteristische gelbe D-Linie des Natrium (~589 nm), sowie zwei typische Peaks von Kalium (~766 nm, ~770 nm) im infraroten Bereich.
Das gezeigt Spektrum wurde mit einem unserer DIY-Spektrometer aufgenommen. Zum Schutz des Lichtleiters wurde über diesen ein normales Reagenzglas gestülpt. Hierdurch konnte dieser relativ dicht vor der abbrennenden Wunderkerze plaziert werden.
Nimmt man während des Abbrennens einer Wunderkerze mehrere Spektren auf, beobachtet man in der Regel, dass manche der typischen Peaks von enthaltenen Metallen und Salzen durch Emission einen zusätzlichen Peak auf dem kontinuierlichen Spektrum erzeugen und manchmal eine Einbuchtung hervorrufen, weil die entsprechende Wellenlänge absorbiert wird. Besonders gut zu beobachten ist dies bei der sehr dominanten Natrium-D-Linie (~589 nm).
Emission der Natrium-D-Linie tritt dann auf, wenn die Temperatur hoch genug ist, um Natrium-Atome zu erzeugen und diese in angeregte Zustände zu bringen. Kalte oder weniger angeregte Natriumatome in der Umgebung der heißen Flamme absorbieren hingegen Licht im Bereich der D-Linie. Dadurch erscheint an dieser Stelle eine Einbuchtung im Spektrum, da das Licht in diesem Bereich abgeschwächt wird.
Ob nun ein Peak oder eine Einbuchtung bei ~589 nm sichtbar wird, hängt dynamisch von der gerade vorherrschenden Balance zwischen Emission und Absorption im Bereich der Flamme ab, die der Lichtleiter des Spektrometers aufnimmt. Da das Abbrennen der Wunderkerze keine stabilen Verbrennungszonen erzeugt, sondern eher chaotisch verläuft, ändern sich die lokalen Bedingungen ständig. Wenn die Emission durch angeregte Natriumatome dominiert, überlagert sie die Absorption. Wenn hingegen mehr Licht durch kalte Natriumdämpfe absorbiert wird, als durch Emission kompensiert wird, entsteht eine Einbuchtung im Spektrum.
Die beobachtete Balance wird durch lokale Flammenbedingungen beeinflusst:
Für die Aufnahme des hier gezeigten Spektrums wurde eine handelsübliche Wunderkerze genutzt, wie diese für Tischfeuerwerke der Kategorie F2 verkauft wird.
Zum Schutz des Lichtleiters wurde über diesen ein entsprechend großes Reagenzglas geschoben und dieses mit Hilfe von Klemmen in einem Abstand von wenigen Millimetern vor der Wunderkerze positioniert.
Zum Einsatz kam ebenfalls eines unserer DIY-Spektrometer:
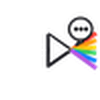 Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.
Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 31.10.2025
