


In diesem Applikationsbeispiel nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise ins Reich der LEDs. Also: ran an die Grabbelkisten! Welche Schätze lassen sich wohl finden? Billig-LEDs aus alten Elektronikprojekten? Vielleicht eine besonders schmalbandige Type? Nur die üblichen, etwas langweiligen Farben – oder sogar ein echtes Highlight, das überrascht?
Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie unterschiedlich LEDs wirklich sind – in Farbe, Intensität und spektraler Breite. Und wer weiß: vielleicht steckt in einer unscheinbaren LED ja ein verborgenes optisches Talent …

In jeder LED steckt ein winziges Stück Halbleitermaterial – und genau dort spielt sich die Magie ab. Wenn Strom durch die LED fließt, bekommen Elektronen in diesem Material ein bisschen Energie »zugeschoben«. Diese Elektronen springen dadurch in einen energetisch höheren Zustand, sozusagen auf eine obere Etage im Energiebereich des Halbleiters.
Doch oben bleiben sie nicht lange. Schon nach winzigen Bruchteilen einer Sekunde fallen sie wieder zurück – und dabei geben sie ihre überschüssige Energie in Form eines Lichtteilchens (Photons) ab. Die Farbe dieses Lichtes hängt nun direkt davon ab, wie groß der Energieunterschied zwischen den beiden Etagen ist – also von der sogenannten Bandlücke des Materials.
Je größer die Bandlücke, desto energiereicher (und damit blauer) ist das ausgesandte Licht. Eine kleinere Bandlücke führt dagegen zu energieärmeren, also rötlicheren Photonen.
Und genau hier kommt die Materialwahl ins Spiel: Durch geschicktes Mischen verschiedener Elemente (z. B. Gallium, Indium, Aluminium, Phosphor, Stickstoff) können die Halbleiterhersteller die Bandlücke gezielt einstellen – und damit die Lichtfarbe der LED bestimmen.
Das Prinzip ist also einfach, aber genial: Elektrischer Strom hinein ➙ Elektronen geben Energie ab ➙ Licht heraus.
Nur die »Treppenhöhe« zwischen den Energieniveaus – also die Bandlücke – entscheidet darüber, ob das Licht rot, grün oder blau leuchtet.
Heute basieren praktisch alle sichtbaren LEDs auf einem von zwei Halbleitermaterialsystemen: AlGaInP (Aluminium-Gallium-Indium-Phosphid) oder InGaN (Indium-Gallium-Nitrid).
Das AlGaInP-System wird vor allem für rote, orangefarbene und gelbe LEDs eingesetzt. Seine Bandlücke liegt im Bereich von etwa 1,9 bis 2,2 Elektronenvolt, was Wellenlängen zwischen rund 650 und 560 Nanometern entspricht. Der große Vorteil dieses Materials liegt in seiner hohen Effizienz im roten Spektralbereich. Allerdings nimmt die Effizienz ab etwa 560 nm deutlich ab – also genau dort, wo das Licht gelbgrün erscheint. Deshalb lassen sich LEDs in diesem Farbton mit AlGaInP kaum sinnvoll realisieren.
Das zweite große Materialsystem, InGaN, deckt den Bereich der blauen, türkisfarbenen und grünen LEDs ab. Auch weiß leuchtende LEDs basieren häufig darauf, indem sie eine blau emittierende LED mit einer Phosphorschicht kombinieren, die einen Teil des Lichts in längere Wellenlängen umwandelt. Die Bandlücke von InGaN lässt sich durch den Indiumgehalt sehr flexibel einstellen und reicht von etwa 2,4 bis 3,4 eV, also von rund 520 bis 370 nm. Diese Flexibilität und Robustheit machen InGaN heute zum technologisch dominierenden LED-Material. Der Nachteil: Je stärker man die Emission in Richtung Gelbgrün verschieben will, desto schwieriger wird es, hohe Kristallqualität und Effizienz zu erreichen – ein Effekt, der als »Green Gap« bekannt ist.
Kurz gesagt: Fast alle modernen LEDs basieren entweder auf AlGaInP (für rot bis gelb) oder auf InGaN (für grün bis blau). Im gelbgrünen Übergangsbereich um etwa 560 nm stoßen beide Systeme an ihre Grenzen, weshalb dort kaum effiziente Typen existieren – das erklärt, warum orange oder gelbgrüne LEDs auf dem Markt so selten zu finden sind.
Für die Aufnahme der folgenden Spektren wurde ein DIY-Spektrometer in Czerny-Turner-Anordnung eingesetzt.
Die Auswertung der aufgenommenen Spektren erfolgte mit einem einfachen Python-Skript, das die wichtigsten Kenngrößen der LED-Emission automatisch bestimmt und direkt in der Grafik visualisiert. Zunächst wird das Maximum der Emissionskurve ermittelt und als grün gepunktete Linie im Diagramm markiert. Dieses Maximum entspricht der Wellenlänge mit der höchsten Intensität, der sogenannten Peak-Wellenlänge der LED.
Zur Bestimmung der Halbwertsbreite analysiert das Skript die Signalhöhe links und rechts des Peaks: Auf der linken Seite wird die Position ermittelt, bei der das Signal auf die halbe Maximalhöhe absteigt – diese Stelle wird durch eine blau gepunktete Linie markiert. Entsprechend zeigt eine rot gepunktete Linie die Position auf der rechten Seite an, an der das Signal wieder auf die halbe Höhe sinkt. Die Wellenlängendifferenz zwischen diesen beiden Linien wird als Halbwertsbreite bezeichnet.
Zusätzlich wird noch die Zentralwellenlänge bestimmt. Dies ist der Mittelwert der Wellenlängen, bei denen das Signal auf die halbe Maximalhöhe abgefallen ist – also der Mittelpunkt zwischen linker und rechter Halbwertsposition.
Alle berechneten Werte – also Zentralwellenlänge, Halbwertsbreite und die Intensität des Maximums – werden vom Skript übersichtlich in einer kleinen Legende am Rand des Diagramms angegeben. So lassen sich unterschiedliche LEDs leicht vergleichen und charakterisieren.
Der Einfluss der spektralen Empfindlichkeit spielt eine entscheidende Rolle, wenn das Spektrometer noch nicht spektral korrigiert wurde. Jedes DIY-Spektrometer besitzt – zusammen mit dem verwendeten Sensor – eine eigene spektrale Empfindlichkeitskurve. Diese wird durch verschiedene Faktoren bestimmt: die Quanteneffizienz (QE) des CMOS- oder CCD-Sensors, die Effizienz des Beugungsgitters sowie die Transmission der eingesetzten Optiken.
Ohne eine entsprechende Korrektur wird das tatsächlich emittierte Spektrum der LED mit dieser sogenannten Systemantwort multipliziert. Dadurch kann sich die gemessene Intensitätsverteilung deutlich von der realen unterscheiden. So erscheinen beispielsweise Spektren roter LEDs oft schwächer und schmaler, wenn die Kamera in diesem Wellenlängenbereich nur eine geringe Empfindlichkeit aufweist. Umgekehrt kann bei blauen LEDs der Peak verzerrt wirken, weil die Empfindlichkeit des Sensors im UV- und Blauvorspann typischerweise stark abfällt. Besonders kritisch ist dieser Effekt für die Bestimmung der Halbwertsbreite: Schon kleine asymmetrische Unterschiede in der Systemantwort können die gemessene Breite des Peaks merklich verändern – und damit zu fehlerhaften Schlussfolgerungen über die tatsächliche spektrale Charakteristik führen.
Studierende erwarten oft eine saubere, symmetrische »Glockenkurve«. In der Realität sieht man jedoch, dass:
Die Emissionswellenlänge einer LED hängt direkt von der Bandlücke des Halbleitermaterials ab: Je größer die Bandlücke, desto kurzwelliger (blauer) ist das Licht.
Die Zwischenbereiche (z. B. orange ~590 nm oder gelbgrün ~560 nm) erfordern sehr genau justierbare Bandlücken – und genau da liegt das Problem.
Rote & orangefarbene LEDs basieren meist auf AlGaInP (Aluminium-Gallium-Indium-Phosphid). Dieses Materialsystem deckt den Bereich von ca. 560 nm bis 650 nm ab; je mehr Aluminium, desto größer die Bandlücke, was zu kürzeren Wellenlängen (also Richtung Gelb/Grün) führt.
Aber: Sobald man bei AlGaInP den Aluminiumanteil zu stark erhöht, verschlechtert sich die Kristallqualität. Das führt zu Defekten, erhöhter Nichtstrahlungsemission und damit zu stark sinkender Effizienz.
Deshalb enden effiziente AlGaInP-LEDs praktisch bei ca. 585 nm (orange) – »echtes Gelb« wird schon schwierig.
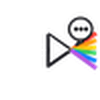 Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.
Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
