


Wer hätte gedacht, dass sich in einem unscheinbaren Leuchtstofflampen-Starter eine ganze Schatzkammer an interessanten Lichtquellen verbirgt? In den kleinen Glasröhrchen, die als Zündhilfe dienen, sind sogenannte Starterlampen eingebaut. Sie arbeiten nach einem einfachen Prinzip: Sobald eine Spannung anliegt, beginnt das enthaltene Gas zu leuchten – und sendet dabei ein charakteristisches Emissionsspektrum aus.
Diese Starterlampen sind nicht nur für die Funktion der Leuchtstofflampe entscheidend, sondern auch ein spannendes Experimentierfeld für Lichttechnik und Spektroskopie. Mit einem DIY-Spektrometer lassen sich die unterschiedlichen Lichtfarben und Spektrallinien sichtbar machen, wodurch das Zusammenspiel von Gasentladung, Lichtemission und elektrischer Spannung anschaulich wird.
Für Technikbegeisterte, Physikstudierende und alle, die sich für Lichtquellen und Spektralanalyse interessieren, bieten Starterlampen damit einen überraschend einfachen Einstieg in die faszinierende Welt der Licht- und Spektralforschung.

Starterlampen sind eine spezielle Bauform von Glimmlampen. Sie bestehen aus einem kleinen Gasentladungsgefäß mit zwei Elektroden, von denen eine als Bimetall ausgeführt ist.
Für unsere Experimente ist vor allem die erste Phase interessant: das charakteristische Glimmen, in dem das Gasgemisch sein Spektrum abstrahlt.
Für Experimente müssen Starterlampen nicht mit Netzspannung betrieben werden. Sie lassen sich sehr einfach mit Invertern für EL-Folien betreiben.
Damit wird aus einem »Abfallprodukt« wie dem Lampenstarter eine preiswerte, leicht zugängliche Lichtquelle für spektroskopische Untersuchungen.
Wir haben unsere Grabbelkiste geplündert und dabei verschiedene alte Starterlampen ausgeschlachtet. Das Ergebnis? Drei völlig unterschiedliche Farbstimmungen:
Mit bloßem Auge ist schon erkennbar: Da steckt mehr drin, als man einem unscheinbaren Starter zutrauen würde. Nun kommt die Auflösung – unser DIY-Spektrometer zeigt, welche Gase wirklich hinter diesen Farben stecken …
Mit bloßem Auge wirkt das Leuchten beinahe geheimnisvoll – kühl, intensiv und etwas außerirdisch. Doch das DIY-Spektrometer bringt schnell Klarheit: Deutliche Peaks zwischen 400 und 500 nm verraten die Handschrift von Argon. Dank der NIST-Datenbank (Atomic Spectra Database | NIST) ¹ lassen sich diese Linien eindeutig zuordnen – aus dem mystischen Glühen wird so ein klarer Fingerabdruck des Gases.

Kaum eingeschaltet, strahlt die kleine Starterlampe in einem warmen, intensiven Rot-Orange – fast so, als hätte man ein Stück Sonnenuntergang eingefangen. Doch auch hier enthüllt das DIY-Spektrometer das Geheimnis: Kräftige Peaks um 585 nm und 640 nm passen perfekt zu den typischen Emissionslinien von Neon, die sich in der NIST-Datenbank (Atomic Spectra Database | NIST) ¹ klar wiederfinden.

Schaut man noch genauer hin, tauchen plötzlich zwei schwache Linien auf, die eindeutig zu Xenon gehören. Ein kleiner Überraschungseffekt, aber was steckt dahinter? Handelt es sich um winzige Verunreinigungen des Füllgases oder vielleicht sogar um eine beabsichtigte Beimischung? Das bleibt offen – spannend ist es allemal.
Bei diesem Starter wirkt das Leuchten ungewöhnlich, ein faszinierendes Gemisch aus kühlen Blautönen und warmem Orange. Was dem Auge wie ein stimmungsvolles Farbspiel erscheint, zerlegt das DIY-Spektrometer in seine Bestandteile: Überlagerte Peaks von Argon und Neon verraten eine Gas-Mischung, die beide Welten in einer Lampe vereint. Ein schönes Beispiel dafür, wie Spektroskopie verborgene Details sichtbar macht.

Wir zeigen hier einmal ein Spektrum mit einer Integrationszeit von 1 s, in dem stärksten Argon-Linien leicht zu identifizieren sind.
Bei einer Integrationszeit von 3 s treten aber noch viel mehr schwächere Linien hervor, vor allem im Bereich zwischen 400 und 500 nm. Bei den stärkeren Argon-Linien gelangt der Sensor in seine Sättigung, was an den Verzerrungen im oberen Signalbereich zu erkennen ist. Dies hat aber keinen störenden Einfluss auf die Detektion der schwächeren Linien.

Unsere Experimente zeigten sehr schön, dass in Starterlampen für Leuchtstoffröhren fast ausschließlich Neon und Argon (oder Mischungen aus beiden) als Füllgase zum Einsatz kommen. Das hat mehrere Gründe:

Das bekannte Flackern beim Einschalten einer Leuchtstofflampe entsteht, weil der Starter die Röhre nicht sofort zündet, sondern mehrmals hintereinander kurze Entladungen einleitet:
¹ Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J., and NIST ASD Team (2023). NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.11), [Online]. Available: https://physics.nist.gov/asd [2024, June 23]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. DOI: https://doi.org/10.18434/T4W30F
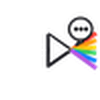 Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.
Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 30.10.2025
